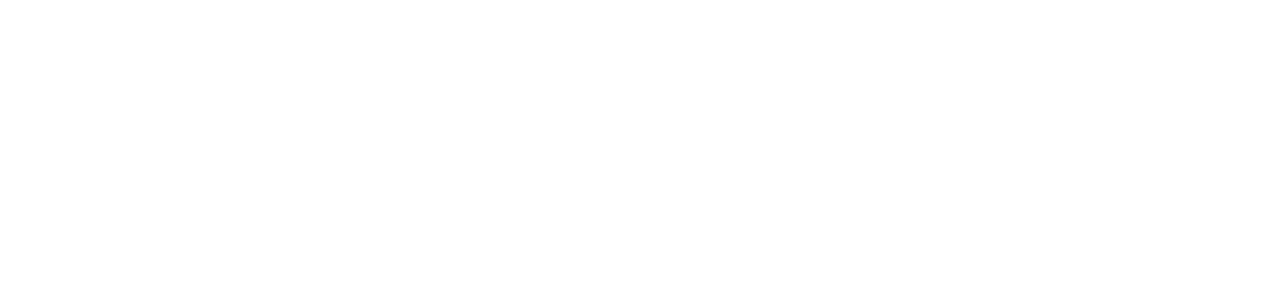In Zeiten steigender Anforderungen im Beruf, in der Familie und im Privatleben gewinnt die Frage nach unserem persönlichen Wohlbefinden zunehmend an Bedeutung. Wer versteht, wie und warum wir zufrieden sind, kann konkrete Schritte unternehmen, um das eigene Lebensglück zu fördern – und damit nicht nur das eigene, sondern auch das Umfeld positiv zu beeinflussen.
Das aktuelle „Zufriedenheits-Plateau“ bietet die Chance, innezuhalten: Wir genießen bereits ein hohes Niveau an Lebenszufriedenheit, doch gerade deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen, wo neue Impulse möglich sind.
Laut SKL Glücksatlas 2025 (https://www.skl-gluecksatlas.de/artikel/gluecksatlas-2025.html) bleibt die durchschnittliche Lebenszufriedenheit in Deutschland mit 7,09 von 10 Punkten praktisch unverändert auf einem hohen Plateau. Weitere zentrale Erkenntnisse:
• Ost-West-Glückslücke schrumpft: Der Osten legt um +0,12 Punkte zu, im Westen steigt die Zufriedenheit nur um +0,02 Punkte.
• Zufriedenheit in Familie, Arbeit und Freizeit verbessert sich leicht, während die Einkommenszufriedenheit vor allem in den unteren Einkommensgruppen um 0,42 Punkte einbricht.
• Positive Emotionen nehmen zu (57 % fühlen sich häufig oder sehr häufig glücklich, 2023 waren es 45 %), aber auch Ärger und Angst gewinnen an Intensität.
• Hamburg führt das Bundesländer-Ranking an, Mecklenburg-Vorpommern (6,06 Punkte) rangiert am Ende. „Overperformer“ und „Underperformer“ zeigen: Subjektives Wohlbefinden korreliert nicht eins zu eins mit objektiven Lebensbedingungen.
• Datenbasis: Über 13.900 Interviews zur allgemeinen Lebenszufriedenheit, wissenschaftlich begleitet von der Universität Freiburg.
Diese Ergebnisse lassen sich gut mit Erkenntnissen der Positiven Psychologie verknüpfen: Modelle wie Seligmans PERMA (Positive Emotionen, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment) unterstreichen, dass unser Glück nicht allein von äußeren Faktoren abhängt, sondern wesentlich davon, wie wir Beziehungen pflegen, Ziele verfolgen und Sinn in unserem Tun finden. Barbara Fredricks Broaden-and-Build-Theorie erklärt, warum positive Emotionen unsere Ressourcen nachhaltig stärken – gerade in unsicheren Zeiten.
Was das für unser tägliches Leben bedeutet
1. Fokus auf wirkliche Bedürfnisse: Nicht immer mehr Einkommen, sondern mehr Erleben in Familie, Freundschaft und Freizeit macht dauerhaft zufrieden.
2. Achtsamkeit für Emotionen: Glücksmomente intensivieren – und negative Gefühle als Signale nutzen, um Veränderungen anzustoßen.
3. Kleine Rituale etablieren: Dankbarkeitstagebuch, kurze Auszeiten oder gemeinsame Aktivitäten fördern unsere Resilienz.
4. Regionale Ressourcen nutzen: Auch in „Underperformer“-Ländern gibt es Nischen von Gemeinsamkeit und Sinn, die wir bewusst suchen können.
Das „Zufriedenheits-Plateau“ ist kein Stillstand, sondern ein solides Fundament für bewusstes Handeln – im Kleinen wie im Großen.
Herzliche Grüße von Dominik